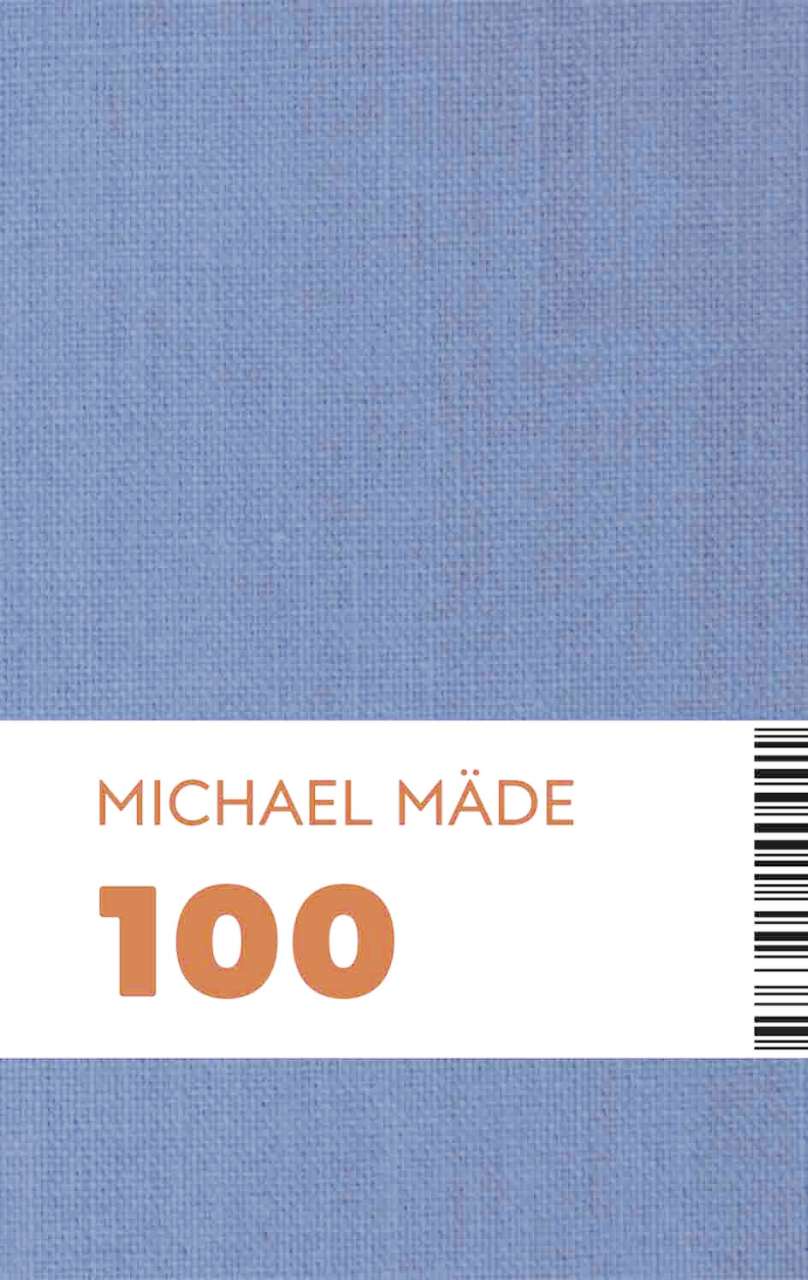Aristoteles widerlegt
Michael Mädes Gedichtband »100«
Michael Mäde wurde 1962 in der DDR geboren. Er studierte Filmwissenschaften und Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam und arbeitete als Dramaturg und künstlerischer Leiter sowie als Kaufmann in verschiedenen Medienunternehmen. Seit 2007 ist er für die Tageszeitung »junge Welt« tätig und ist unter anderem für deren Ladengalerie verantwortlich, das heißt für einen Veranstaltungsort, der sich trotz enormer Konkurrenz durch seine Lesungen, Vorträge, Konferenzen, Konzerte von Liedermachern und vor allem durch seine Ausstellungen mit antifaschistischer und DDR-Kunst in Berlin fest etablieren konnte.
Sein Gedichtband »100«, der dritte im Verlag Wiljo Heinen, ist äußerlich ein Muster für selten gewordene Buchkunst – vom schlichten einfarbigen blauen Leineneinband mit Banderole bis zu Typographie und Papierauswahl. In den Gedichten berichtet zumeist ein Ich-Erzähler auf unsentimentale und deswegen ergreifende Weise etwa von eigenen bitteren Erfahrungen als Kind einer kommunistischen Familie, das auch in Zeiten des Sozialismus von Gleichaltrigen schikaniert wurde, vor allem aber von den Verheerungen, von der »Landnahme der Kriege« nach dem Ende des ostdeutschen Staates. Unter der Überschrift »Ein Morgen im März« heißt es zum Beispiel: »So blau war der Morgen, so endlos. Endlich / jubeln die angeschlossenen Funkhäuser. / Endlich frohlockt die Presse der Erpresser. / Und nur über Belgrad regnet es, / passend zur Jahreszeit, Bomben.«
Diese Verse aus der vergößerten BRD, der Anschlussrepublik, lesen sich oft, als seien sie von einem Emigranten geschrieben – aus geistiger Distanz zum Unheilvollen, unversöhnlich, oft sarkastisch. Die wenigen Gedichte über Liebe und eigenes Leid wirken wie eine Zuflucht. In der politisch inspirierten Poesie der vergangenen Jahrzehnte gibt es Vergleichbares nur bei Peter Hacks. An ihn reicht manches hier Veröffentlichte heran.
Bittere Erfahrungen in der DDR? Sie haben mit Niederlagen zu tun, eigenen und denen der internationalen sozialistischen Bewegung. Das beginnt programmatisch im ersten Gedicht: »Schwester, heut habe ich deinen Geburtstag vergessen«. Es zerreißt das erzählende Ich immer noch, wie die Schwester 1973 mit der Nachricht vom Tod Salvador Allendes in Chile in der Tür stand und sich nicht trösten lassen wollte: »ich hätte meinen Trost so sehr gebraucht«.
Wer damals in der DDR lebte, weiß, welche unheilvolle Zäsur der Putsch in Chile bedeutete. Da wurde im Blut erstickt, was auch hier neue Begeisterung für Sozialismus geweckt hatte. In einem Text aus dem »Danach« taucht der Faschistenputsch wieder auf: »Mein Weltbild wird einfacher mit den Jahren. Denn Allende, lerne ich, war irgendwie auch Stalinist und Neruda kein Dichter.«
Und immer
in ruhlosen Nächten,
erscheinen ihm jene,
die vom Holm der Wende
von Deck geschlagen,
geächtet,
gebrochen,
hingerafft
von Erschöpfung,
erstickt
an ihrer Geschichte,
die nichts mehr zählte,
plötzlich.
Die teuren Toten
der Revolution,
die niemals gesiegt hat
in diesem halben,
deutschen Land.
Der Ich-Erzähler kann die neuen Herren selten ernst nehmen, von »Teilnehmung« keine Spur mehr. Die Kindheitserfahrungen in der DDR waren direkt und brutal: »mit der Zeit wurde ich würdig befunden meinen Teil an Schlägen in Empfang zu nehmen. Und so schleppte ich nach der Wahl in den Freundschaftsrat heulend meine zerfetzte Schultasche zur Mutter und die wusch das Rot aus dem blauen Halstuch.« Oder: »Die ersten Schläge wegen eines Abziehbildes, verbittertes Schwingen mit dem Lineal. ‚Kommisau’, heult es/unterdrückt…«. Oder: »Ausgesetzt dem Terror/der Andersdenkenden/auf dem Schulhof, Prügel in den Pausen. … Und sicher nun auch, / dass man Grausamkeit / lernen kann.« Da sieht einer Ursachen für das Ende aber auch anderswo, wenn er von den »teuren Toten der Revolution, die niemals gesiegt hat in diesem halben, deutschen Land« schreibt. So auch in »Generation Exil«: »Sie müssen geahnt haben wie schwer das wird, Jahrhunderte von Hass und eingeübter Kriecherei zu überwinden.«
1989 und 1990 ist beides wieder da und kommt nach oben: »Und schon bald buchstabierte man Stettin schon wieder viel selbstverständlicher als Auschwitz in diesem Land.« Sofort sind genügend »Ehrensoldanwärter, die einen Wink nur brauchen, um zu handeln, nicht nur zu hetzen« vorhanden. Und dann das allgegenwärtige Grauen, in allen zwölf Abschnitten des Buches, eben jene »Landnahme der Kriege«: »Die Nachrichten des Tages verwirren ihn. War gestern schon Krieg? Oder hat der nie aufgehört? Jede Geschichte, sagt Aristoteles, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende.« Das findet er hinreichend widerlegt. Und kann dem nicht entgehen: »Mein Sohn hat Waschtag. Träge rekelt sich der Kampfanzug. Trainingsanzüge mit hässlichen Vögeln reihen sich auf der Leine. Der Wind höhnt ums Haus. Auf meiner Terrasse trocknet die Wäsche der feindlichen Armee.« Es ist der stärkste Abschnitt des Bandes.
Die Haltung, mit der Mäde schreibt, findet sich bei Brecht und Hacks, um die Namhaftesten zu nennen. Hacks stiftet auch den Titel für zwei Abschnitte des Bandes: »Plagejahre«. Seine Definition lautete: »Plagejahre, Übergang – Manches dauert gar zu lang.«
Und steigert sich. Im letzten Abschnitt (»Kleine Virenkunde«) schildert Mäde, was die Pandemie für die Ärmsten der Welt bedeutet. Die letzten Zeilen des Bandes lauten: »Das ist der Krieg Klasse gegen Klasse im Jahre 2020 ‚nach Christus’«. Das hätte auch der Titel des Bandes sein können.
Michael Mäde
100
Verlag Wiljo Heinen
Berlin und Böklund 2020
176 Seiten, 20 Euro (D)
ISBN 978-3-95514-044-1